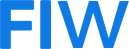Studie „Eine Wachstumsagenda für Deutschland“ des Beratergremiums der Bundeswirtschaftsministerin
Studie: Eine Wachstumsagenda für Deutschland
Bereits im Juni 2025 hatte Bundeswirtschaftsministerin Reiche ein ökonomisches Beratergremium ernannt, das die Wirtschaftsministerin zu Fragen der Marktwirtschaft und Ordnungspolitik beraten sollte. Er fungiert als „wissenschaftlicher Beraterkreis für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik“.
Am 27. September 2025 hat das Gremium die Studie „Eine Wachstumsagenda für Deutschland“ vorgestellt, die im Auftrag des Bundesministeriums (BMWE) entstanden ist. Die Autorenschaft liegt bei Prof. Dr. Veronika Grimm (TU Nürnberg), Prof. Dr. Justus Haucap (Universität Düsseldorf), Prof. Dr. Stefan Kolev (Ludwig-Erhard-Forum) und Prof. Volker Wieland, Ph.D. (Goethe-Universität Frankfurt).
Die Analyse des wissenschaftlichen Beraterkreises des Bundesministeriums unterstreicht in der Studie die Notwendigkeit eines tiefgreifenden Strukturwandels in der deutschen Wirtschaft. Die Studie fordert eine ordnungspolitische Neuausrichtung, die Wettbewerb und Innovation in den Mittelpunkt stellt. Für das Wettbewerbsrecht bedeutet das eine Rückbesinnung auf seine Kernfunktion: die Sicherung offener Märkte und die Verhinderung von Marktmachtmissbrauch – auch durch staatliche Akteure. Der Strukturwandel dürfe nicht durch protektionistische Maßnahmen behindert werden, sondern müsse durch einen klaren rechtlichen Rahmen begleitet werden, der Innovationen fördert und faire Wettbewerbsbedingungen sicherstellt. Dabei wird insbesondere die energieintensive Industrie als potenzieller Verlierer einer innovationsgetriebenen Transformation identifiziert. Fragen, die das Wettbewerbsrecht betreffen, beziehen sich auf Folgende: Wie weit darf und soll der Staat in Marktprozesse eingreifen, um bestehende Industrien zu stützen, und wo beginnt die wettbewerbsverzerrende Marktintervention (S. 12-13)?
Die Autoren plädieren für eine Stärkung marktwirtschaftlicher Dynamiken und eine Begrenzung staatlicher Zielsteuerung. Wettbewerb wird dabei als dezentrales und wettbewerbliches Entdeckungsverfahren verstanden, das Innovationen fördert und Fehlallokationen korrigiert (S. 7, 22). Marktprozesse sollen möglichst unbeeinflusst verlaufen, um Effizienzgewinne und Verbraucherwohlfahrt zu maximieren:
Gleichzeitig wird vor einer industriepolitischen Strategie gewarnt, die auf die Erhaltung etablierter Strukturen abzielt – etwa durch Subventionen oder regulatorische Privilegien für energieintensive Branchen. Solche Maßnahmen könnten nicht nur zu Wettbewerbsverzerrungen führen, sondern auch die Innovationskraft neuer Marktteilnehmer behindern. Die Autoren sprechen sich daher gegen die Schaffung „nationaler Champions“ durch eine Lockerung der europäischen Fusionskontrolle aus. Hierzu heißt es wörtlich (S. 26):
Während markthemmende Regulierungen systematisch abgebaut werden sollten, müssen
wettbewerbsfördernde Institutionen gestärkt werden: Dazu zählen etwa das Kartellrecht,
die Kontrolle marktbeherrschender Stellungen und ein diskriminierungsfreier Zugang
zu Infrastrukturen und Märkten. Weder auf deutscher noch auf europäischer Ebene sollte
die Durchsetzung des Kartellrechts inklusive der Fusionskontrolle geschwächt werden, wie
einige Industrievertreter in Reaktion auf den Draghi-Report fordern, um durch wettbewerbshemmende Zusammenschlüsse vermeintliche europäische Champions zu kreieren. Gerade in Zeiten technologischer Umbrüche und zunehmender Marktkonzentration ist es unerlässlich, marktwirtschaftliche Dynamik nicht nur zu ermöglichen, sondern auch ihrer Gefährdung durch Monopolisierungstendenzen oder politische Vereinnahmung entgegenzutreten. So sollte etwa die wettbewerbsfördernde Regulierung digitaler Gatekeeper durch den Digital Markets Act (DMA) der EU nicht Gegenstand von handelspolitischen Verhandlungen mit den USA werden.
Auch bezweifeln die Autoren die langfristige Wirksamkeit staatlicher Kompensationsmaßnahmen und plädieren für eine Reallokation von Ressourcen in weniger energieintensive Sektoren. Besonders kritisch sehen die Autoren auch die Auswirkungen der EU-Taxonomie, des Lieferkettengesetzes und der geplanten CSDDD. Diese Normen erzeugten hohe Compliance-Kosten, die insbesondere kleine und mittlere Unternehmen belasten und deren Wettbewerbsfähigkeit einschränken. Eindringlich sprechen sich die Studienersteller zudem dafür aus, dass Deutschland auf nationale Sonderwege, insbesondere das „Gold-Plating“ verzichten sollte, da die „systematische Übererfüllung von EU-Vorgaben im nationalen Recht […]zu zusätzlicher Komplexität, höheren Kosten und Wettbewerbsnachteilen gegenüber anderen Mitgliedstaaten“ führe.