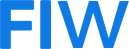Veröffentlichter Expertenbericht von Mario Draghi zur Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit
EU-Kommission
Draghi-Bericht
Binnenmarkt
Wettbewerbsfähigkeit
Wettbewerbsrecht
Beihilfenrecht
IPCEI
New Competition Tool
Link zum Bericht: EU competitiveness: Looking ahead –
European Commission (europa.eu)
Am 9.
September 2024 hat der ehemalige EZB-Präsident Mario Draghi im Auftrag der
Europäischen Kommission einen 400-seitigen Bericht vorgelegt, der die Herausforderungen
für die Wettbewerbsfähigkeit der EU beleuchtet. Er gilt als richtungsweisend für die politische Agenda der kommenden
fünf Jahre. Neben den Themen Innovation und Sicherheit/Verteidigung nimmt die grüne Transformation im Bericht eine
zentrale Rolle ein. Draghi analysiert die aktuellen Ausgangslagen und Herausforderungen und unterbreitet vielfältige
Handlungsvorschläge.
Für den
Bereich des Wettbewerbsrechts betont Draghi, dass das Grundprinzip des fairen und freien Wettbewerbs zur
Gewährleistung eines Level Playing Fields für Unternehmen im Binnenmarkt nach wie vor gültig bleibe, es aber an die
sich radikal ändernden Rahmenbedingungen angepasst werden müsse. Die Herausforderung bestehe darin, ein
Gleichgewicht zwischen der Einhaltung wettbewerbsrechtlicher Grundsätze und der Notwendigkeit von Skaleneffekten und
Innovationsanreizen für europäische Unternehmen herzustellen. Die wachsende Bedeutung von digitalen Technologien,
Daten und Netzwerkeffekten verändere die Art und Weise, wie Wettbewerb funktioniert. Auf vielen Märkten gehe es beim
Wettbewerb nicht mehr nur um die Preisgestaltung, sondern um Innovation und Skaleneffekte. Die Wettbewerbsbehörden
müssten vorausschauender urteilen, das nötige technische Know-How entwickeln und schnellere Entscheidungen treffen.
Hierzu würden auch verstärkte Ressourcen benötigt.
Im
Einzelnen fordert Draghi im Kapitel „Revamping Competition Policy“, in der Fusionskontrolle zukunftsgewandter zu
entscheiden und Innovations- und Effizienzaspekte stärker im Wege einer „Innovations- oder Effizienzeinrede“ zu
berücksichtigen, die Verfahren der GD Wettbewerb zu beschleunigen und zu vereinfachen sowie IPCEIs im weiteren
Umfang zu nutzen. Er spricht sich auch für klare Regeln zur wettbewerbsrechtlichen Bewertung von Kooperationen aus.
Diese könnten erforderlich sein, um beispielsweise Forschungsinvestitionen oder Nachhaltigkeitsinitiativen überhaupt
zu ermöglichen. Für Unternehmen müsse klar erkennbar sein, welche Kooperationen sie ohne rechtliche Risiken eingehen
könnten. Hierzu würden entsprechende klare Leitlinien und Vorlagen benötigt
Nach
Ansicht Draghis nehme die derzeitige Wettbewerbsdurchsetzung nicht ausreichend Bezug auf Aspekte wie Sicherheit,
Resilienz und mit diesen Bereichen verbundene Risiken für die europäische Wirtschaft. Er schlägt vor, eine
Sicherheits- und Resilienzbewertung durchzuführen in Wettbewerbsfällen, in denen diese Dimensionen besonders
relevant seien, und für Unternehmen und Sektoren, die von strategischer Bedeutung seien (genannt werden Sicherheit,
Verteidigung, Energie und Raumfahrt). Diese Bewertung soll nicht durch die DG Wettbewerb, sondern durch eine externe
Stelle, z. B. durch ein „Resiliency Assessment Body“ durchgeführt werden.
Der
Bericht betont darüber hinaus die Bedeutung der Beihilfekontrolle und bewertet die Krisenbeihilfen der vergangenen
Jahre, die größtenteils zu unkoordinierten nationalen Fördermaßnahmen und einer Fragmentierung des Binnenmarktes
geführt hätten, kritisch. Es sei nun wichtig, zum einen wieder zurück zu einer strengen Anwendung der
Beihilfekontrolle zu kommen und zum anderen nationale Fördermaßnahmen verstärkt auf EU-Ebene zu koordinieren, um
Produktivität und Wachstum in strategischen Sektoren zu erweitern. Neben einer Ausweitung des IPCEI-Instrumentes
schlägt der Bericht vor, in der beihilferechtlichen Bewertung die Kohärenz der Beihilfen mit Vorgaben der
EU-Industriepolitik sowie die potenziellen Auswirkungen auf Innovation und Resilienz stärker zu berücksichtigen. In
Bereichen, in denen nationale Fördermaßnahmen auf europäischer Ebene koordiniert werden, sollen höhere
Beihilfebeträge zugelassen werden. Für den Energiebereich enthält das entsprechende Kapitel Vorschläge zur
beihilferechtlichen Ermöglichung von Preisentlastungsmechanismen.
Der
Draghi-Bericht zielt auch auf die Einführung eines New Competition Tools (NCT) in vier Bereichen, in denen
seiner Meinung nach die derzeitigen Wettbewerbsinstrumente unzureichend sein sollen. Er nennt in dem Zusammenhang i)
stillschweigende Absprachen; ii) Märkte, auf denen Verbraucherschutz eher erforderlich ist, z. B. weil die
Verbraucher zu sensiblen Gruppen gehören oder Verhaltensverzerrungen (behavioural biases) haben; iii) Märkte, auf
denen die wirtschaftliche Belastbarkeit schwach ist, was u.a. an der Marktstruktur liegen könnte (u.a. Abhängigkeit
von einer einzigen Rohstoffquelle), die zu häufigen Engpässen oder anderen schädlichen Folgen führt; iv) frühere
Durchsetzungsmaßnahmen, bei denen die bei der Behörde eingegangenen Informationen/Daten darauf hindeuten, dass die
eingegangenen Verpflichtungen oder Abhilfemaßnahmen nicht zu mehr Wettbewerb führen.
Auf
europäischer Ebene ist 2020 ein flächendeckenden „NCT“ seinerzeit abgelehnt und stattdessen mit dem Digital
Markets Act eine sektorspezifische Regulierung nur für große digitale Gatekeeper vorgelegt worden. Es war zu
dem Zeitpunkt kein Grund ersichtlich, ein neues Regulierungsinstrument für alle Branchen und Märkte vorzusehen.
Neben offenen und streitigen Kompetenzfragen ist auffallend, dass Draghi an dieser Stelle weder Sektoren nennt, noch
eine stichhaltige Begründung für seinen Vorschlag anführt.