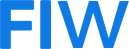Wissenschaftlicher Beirat beim BMWE: Gutachten zur Industriepolitik
Am 26. August 2025 hat der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie das Gutachten „Industriepolitik in Europa“ veröffentlicht. Federführend war Achim Wambach, Präsident des ZEW – Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung und Professor an der Universität Mannheim.
Das Gutachten analysiert die Rolle staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen wie Klimaschutz, Digitalisierung, geopolitischer Spannungen und des globalen Subventionswettlaufs. Es plädiert für eine industriepolitische Strategie, die marktkonform, transparent und europäisch koordiniert ist. Der Beirat äußert sich kritisch gegenüber der gegenwärtigen europäischen Industriepolitik:
- Erstens seien die Zielsetzungen vieler Förderprogramme zu breit gefasst und nicht ausreichend priorisiert. Die gleichzeitige Verfolgung von Klimaschutz, Resilienz, Digitalisierung und Wettbewerbsfähigkeit führe zu einer Überfrachtung der Maßnahmen und erschwere eine zielgerichtete Umsetzung.
- Zweitens mangele es an empirischer Evidenz: Fördermaßnahmen würden häufig ohne systematische Evaluierung eingeführt, sodass ihre tatsächliche Wirkung unklar bleibe.
- Drittens bestehe die Gefahr politischer Einflussnahme, da industriepolitische Entscheidungen teils von Lobbyinteressen geprägt seien.
- Viertens warnt der Beirat vor einem ineffizienten Subventionswettlauf, insbesondere als Reaktion auf den US-amerikanischen „Inflation Reduction Act“ (IRA), bei dem EU-Staaten versuchten, mit eigenen Subventionen gegenzusteuern.
Industriepolitik sei den Gutachtern nach nur dann gerechtfertigt, wenn ein klar identifizierbares Marktversagen vorliege (etwa bei externen Effekten, Netzwerkeffekten oder strategischer Bedeutung einzelner Sektoren). Der Beirat unterscheidet zwischen horizontalen (z. B. Infrastruktur, Bildung, Forschung), vertikalen (gezielte Förderung einzelner Branchen) und strategischen Maßnahmen (Sicherung kritischer Lieferketten). Nur unter bestimmten Bedingungen seien vertikale und strategische Eingriffe sinnvoll.
Ausführlicher äußert sich das Gutachten zur Beihilfen- und Wettbewerbspolitik (S. 23–24). Gefordert wird eine strikte Begrenzung staatlicher Beihilfen auf Fälle mit eindeutigem Marktversagen. Allgemeine Standortförderung oder protektionistische Maßnahmen seien abzulehnen. Das EU-Beihilfenrecht müsse reformiert werden, insbesondere die derzeitigen Ausnahmen und Flexibilisierungen sollten zeitlich und inhaltlich begrenzt werden. Einheitliche Kriterien zur Bewertung von Beihilfen seien notwendig, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.
Die Wettbewerbspolitik müsse gestärkt werden, um aktiv gegen marktverzerrende Subventionen vorzugehen, auch international. Die EU solle handelspolitische Instrumente nutzen, um auf Subventionen in Drittstaaten zu reagieren. Nationale Wettbewerbsbehörden sollten mit mehr Ressourcen und Kompetenzen ausgestattet werden, um Beihilfen kritisch prüfen zu können.
Abschließend fordert der Beirat mehr Transparenz und eine systematische Evaluierung aller Fördermaßnahmen. Eine zentrale europäische Datenbank für Subventionen und Fördermaßnahmen sei notwendig, um die Wirksamkeit und Effizienz staatlicher Eingriffe nachvollziehbar zu machen.