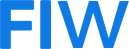Deutsche und französische Unternehmer fordern Reform der EU-Fusionskontrolle
Deutsche und französische Unternehmer fordern Reform der EU-Fusionskontrolle
Brief: Evian‑Brief (PDF)
Im Vorfeld des deutsch-französischen Treffens in Évian am 6. Oktober 2025 hatten 46 Vorstandsvorsitzende führender europäischer Unternehmen einen offenen Brief an Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz veröffentlicht. Darin fordern sie eine tiefgreifende Reform der europäischen Wettbewerbs- und Fusionskontrollpolitik, um – so heißt es im Schreiben – die Entstehung „European Champions“ zu ermöglichen und die wirtschaftliche Souveränität Europas zu stärken. Neben einer grundlegenden Neuausrichtung der Fusionskontrolle sprechen sich die Unterzeichner für umfassende Deregulierung, den Ausbau der Kapitalmarktunion, eine wettbewerbsorientierte Energiepolitik und eine strategische Neuausrichtung der Europäischen Union aus.
Kernforderungen des Briefs
- Reform der Fusionskontrolle: Die Unterzeichner des „Evian Calls“ sehen in der derzeitigen europäischen Fusionskontrollpraxis ein strukturelles Hindernis für die globale Wettbewerbsfähigkeit europäischer Industrien. Sie fordern, dass die einschlägigen EU‑Regeln – insbesondere die Fusionskontrollverordnung (VO 139/2004) und die dazugehörige Kommissionspraxis – bis Ende 2025 grundlegend überarbeitet werden. Kern der Forderung ist eine strategische Neubewertung des Wettbewerbsbegriffs: Nicht mehr allein die Marktstellung im europäischen Binnenmarkt, sondern die Fähigkeit, im globalen Wettbewerb mit US‑, chinesischen und zunehmend auch indischen Konzernen zu bestehen, soll entscheidend sein.
- Deregulierung: Die CEOs sprechen sich für die Aufhebung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtenrichtlinienentwurfs aus. Zentrale Digitalgesetze wie der Data Act und der AI Act sollen ausgesetzt und überarbeitet werden. Neue EU‑Vorgaben sollen vorerst nicht weiter vorangetrieben und uneinheitliche Regeln bis zum 1. Januar 2027 vereinfacht werden.
- Kapitalmärkte: Es soll mehr Eigenkapital für Unternehmen mobilisiert werden. Vorgesehen sind ein zusätzliches einheitliches Regelwerk für die Kapitalmärkte, EU‑weite Sparprodukte mit Absicherung durch die EZB sowie der Abbau von Hürden für grenzüberschreitende Investitionen.
- Energiepolitik: Die Verringerung kostenloser Emissionszertifikate soll bis Januar 2026 aufgeschoben und erst fortgesetzt werden, wenn die Wirksamkeit des CO2‑Grenzausgleichs nachgewiesen ist. Zudem werden eine technologieoffene Ausrichtung und der Ausbau eines zusammenhängenden europäischen Stromnetzes gefordert.
- Strategische Souveränität: In sicherheitsrelevanten Bereichen wie Verteidigung und Pharma sollen Anbieter aus Europa bei öffentlichen Aufträgen gezielt gestärkt werden, ohne das Prinzip offener Märkte und fairen Wettbewerbs aufzugeben.
Reaktionen aus Wettbewerbsbehörden
Der Präsident der französischen Wettbewerbsbehörde, Cœuré, äußerte auf LinkedIn Kritik an dem Brief (LinkedIn‑Beitrag). Er bezeichnete ihn als gut gemeint, jedoch von Stereotypen geprägt und von einem unzureichenden Verständnis der Wettbewerbsregeln geprägt. Er stellte in Frage, dass die Fusionskontrolle „European Champions“ verhindert habe, und verwies auf den Fall Siemens/Alstom als Beispiel für den Nutzen mehrerer starker Anbieter gegenüber lokalen Monopolen. Die Einstufung von Märkten als „global“ adressiert nach seiner Auffassung nationale Fragmentierungen nicht und liefert daher kein ausreichendes Argument für gelockerte Fusionskontrolle. Als zentrales Hemmnis für Wachstum benannte er die Zersplitterung des Binnenmarkts entlang nationaler Grenzen, nicht eine zu enge Marktabgrenzung durch die Behörden.
Andreas Mundt, Präsident des deutschen Bundeskartellamts, stimmte dem Beitrag von Präsident Cœuré zu und lehnte die Vorstellung ab, dass Europas Wettbewerbsfähigkeit von der Lockerung der Wettbewerbsregeln abhänge (LinkedIn‑Beitrag). Im Gegenteil sei eine starke und unabhängige Durchsetzung des Wettbewerbsrechts Teil der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Wie Cœuré sieht er die Notwendigkeit eines stärker integrierten Binnenmarkts und forderte, die Fragmentierung zu beseitigen statt die Wettbewerbsregeln zu lockern, die faire und dynamische Märkte sichern.
Die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission sowie Kommissarin für Wettbewerb, Ribera, äußerte sich ebenfalls kritisch zu den Forderungen der CEOs:
“Competitiveness cannot come at the expense of the environmental and social standards that define Europe’s democracies and remain the backbone of our shared prosperity. No one should be mistaken we will not lower these standards because there is no competitiveness in a race to the bottom. This is equally true for competition policy. We will not carve out exceptions for the powerful or be soft to serve vested interests. Competition policy is one of the tools we can count on to safeguard democracy by balancing power and ensuring it never becomes excessive. Markets should work for people, not the other way around.We should not fall into the trap of excessive power or monopolies damaging Europe’s interests: damaging sustainability or innovation.” (https://www.linkedin.com/posts/teresa-ribera-42a08b340_i-appreciate-the-commitment-to-a-more-competitive-activity-7382472406256381952-P8im?utm_source=social_share_send&utm_medium=member_desktop_web&rcm=ACoAABCddgQBqH4V64GZrCEYLPrhbN59Zhf_JXY)
Mit dieser klaren Haltung unterstreicht Ribera, dass Wettbewerbsfähigkeit und Wettbewerb nicht durch Abbau von Standards, sondern durch strategische Investitionen, faire Marktbedingungen und eine kohärente Industriepolitik erreicht werden sollen.