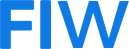14. Policy Brief der Monopolkommission zum EU-Wettbewerbsrecht
https://monopolkommission.de/images/Policy_Brief/MK_Policy_Brief_14.pdf
Die Monopolkommission hat am 9. Oktober 2025 ihrem Policy Brief Nr. 14 (Oktober 2025) unter dem Titel „EU-Wettbewerbsrecht: Mehr Tempo, mehr Durchschlagskraft!“ mit einer Reihe von Empfehlungen zu den aktuellen Überarbeitungsplänen der EU-Kommission für das EU-Wettbewerbsrecht vorgelegt. Anlass sind die laufenden Konsultationen zur Überarbeitung der EU-Kartellverfahrensverordnung (VO 1/2003) sowie der Leitlinien zur Fusionskontrolle.
Kartellverfahren und Missbrauchsaufsicht:
In ihrem Policy Brief kritisiert die Monopolkommission die teils überlangen Verfahren der EU-Kommission, insbesondere bei Missbrauchsfällen. Sie schlägt vor, verbindliche Verfahrensfristen von zwei Jahren einzuführen, um die Effizienz zu steigern. Zudem sollen die Nachweisanforderungen reduziert werden, um „Materialschlachten“ zu vermeiden, bei denen Unternehmen durch übermäßige Datenlieferungen die Verfahren verzögern. Die Kommission empfiehlt eine frühzeitige Fokussierung auf zentrale Streitpunkte und eine Begrenzung der Schriftsatzrunden.
Obwohl die Kartellverfahrensverordnung einstweilige Maßnahmen erlaubt, wird diese Möglichkeit kaum genutzt. Die Monopolkommission fordert daher eine Senkung der Eingriffsschwelle, um bei drohenden irreversiblen Wettbewerbsverzerrungen schneller reagieren zu können. Sie plädiert auch für effektivere Abhilfemaßnahmen zur Wiederherstellung des Wettbewerbs und plädiert für einen stärkeren Einsatz struktureller Maßnahmen, etwa die Herauslösung von Diensten aus digitalen Ökosystemen, wenn verhaltensorientierte Maßnahmen nicht ausreichen. Strengere nationale Regelungen im Bereich der Missbrauchsaufsicht sollten nach Ansicht der Monopolkommission neben dem EU-Recht weiterhin zulässig bleiben.
Fusionskontrolle:
Die Monopolkommission lehnt die im Draghi-Bericht vorgeschlagene „innovation defence“ ab, wonach Fusionen mit dem Ziel der Innovationsförderung erleichtert werden sollen. Sie warnt davor, dass dies den Wettbewerb und damit letztlich auch die Innovationsanreize gefährden könnte. Stattdessen fordert sie eine differenzierte Bewertung der dynamischen Effekte von Zusammenschlüssen. In dem Zusammenhang empfiehlt sie, dynamische Schadenstheorien systematisch in die Fusionskontrolle zu integrieren. Diese sollen die Auswirkungen von Zusammenschlüssen auf Innovationen und Investitionen besser erfassen. Dazu gehören u. a. die Eliminierung potenzieller Innovatoren, die Reduktion von Innovationsdruck durch Marktkonzentration und Pipeline-Effekte bei überlappenden Forschungsprojekten. Gleichzeitig sollen auch positive Effekte wie technologisches Spillover und gemeinsame Ressourcennutzung berücksichtigt werden. Nachhaltigkeitsverbesserungen durch Zusammenschlüsse sollen hingegen als Effizienzgewinne anerkannt werden, auch wenn sie schwer quantifizierbar sind.