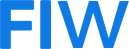Arbeitskreis Kartellrecht beim Bundeskartellamt tagte zum Thema Fusionskontrolle
Arbeitspapier: AK_Kartellrecht_2025_Hintergrundpapier.pdf
Am 9. Oktober 2025 fand beim Bundeskartellamt die Tagung des Arbeitskreises zum Kartellrecht („Professorentagung“) statt. Der Arbeitskreis tagt jährlich zu verschiedenen aktuellen wettbewerbsrechtlichen Themen und setzt sich aus Professoren rechts- und wirtschaftswissenschaftlicher Fakultäten, hochrangigen Vertretern nationaler und europäischer Wettbewerbsbehörden und Ministerien sowie Richtern der Kartellsenate beim OLG Düsseldorf und beim Bundesgerichtshof zusammen.
Im Zentrum der Diskussion stand die Frage, wie die Fusionskontrolle angesichts neuer wirtschaftlicher und politischer Herausforderungen weiterentwickelt werden sollte. Das Hintergrundpapier des Bundeskartellamts nimmt auch zur geplanten Überarbeitung der europäischen Fusionskontrollleitlinien Stellung und formuliert dabei eine differenzierte, aber auch kritische Position gegenüber einer möglichen konzeptionellen Erweiterung der Fusionskontrolle. Das Bundeskartellamt erkennt an, dass sich die ökonomischen Rahmenbedingungen verändert haben: Digitalisierung, datengetriebene Geschäftsmodelle, makroökonomische Schocks und geopolitische Spannungen stellen neue Anforderungen an die Wettbewerbspolitik. Auch sei der politische Wille, industrie- oder strukturpolitische Ziele wie Innovationsförderung, Resilienz oder Nachhaltigkeit in die Fusionskontrolle einzubeziehen, größer geworden.
Das Bundeskartellamt warnt in seinem Arbeitspapier davor, die Fusionskontrolle zu einem Instrument industriepolitischer Zweckverfolgung werden zu lassen. Es betont, dass die Integrität des Wettbewerbsrechts als neutraler Ordnungsrahmen gewahrt bleiben muss. Die geltende Fusionskontrollverordnung setze klare Grenzen: Maßgeblich für die Prüfung von Zusammenschlüssen seien die Auswirkungen auf den Wettbewerb. Eine Ausweitung auf politische Zielsetzungen würde zu einer Politisierung der Fusionskontrolle führen, die für Wettbewerbsbehörden kaum handhabbar wäre.
Gleichzeitig zeigt das Papier auf, wo bestehende Instrumente weiterentwickelt werden könnten. Das Bundeskartellamt fordert mehr Rechtssicherheit und klarere Kriterien bei der Transaktionswertschwelle im Lichte der jüngsten Rechtsprechung (Meta/Kustomer). Das Papier diskutiert weitere Reformoptionen, darunter die Einführung eines zusätzlichen Call-In-Regimes oder die Kombination einer vereinfachten Transaktionswertschwelle mit einem Call-In-Element und einem Vollzugsverbot. Dabei wird betont, dass jede neue Regelung rechtssicher und verhältnismäßig ausgestaltet sein müsse.
Auch die erweiterte Verpflichtung zur Anmeldung nach § 32f Abs. 2 GWB beleuchtet das Papier kritisch. Zwar biete sie die Möglichkeit, Fälle unterhalb der regulären Schwellenwerte in konzentrierten Märkten zu erfassen, doch sei die praktische Umsetzung komplex und bürokratisch. Das Bundeskartellamt hinterfragt, ob der Ansatz, eine Sektoruntersuchung vorauszusetzen, weiterhin zielführend sei oder ob man für diese Fälle abstraktere Kriterien aufstellen könne, die eine Kontrolle potenziell wettbewerbsschädlicher Zusammenschlüsse ermöglicht.
Besonders kritisch äußert sich das Bundeskartellamt zur Einbeziehung neuer materieller Kriterien in die Fusionskontrollleitlinien. Es weist daraufhin, dass funktionierender Wettbewerb die beste Grundlage für Wachstum und Resilienz sei. Eine Lockerung der Kontrolle zugunsten sogenannter „European Champions“ wird abgelehnt. Auch bei der Bewertung von Innovationen fordert das Amt eine differenzierte Betrachtung: Fusionen können Innovationsprozesse fördern, aber auch behindern, etwa durch die Einstellung von Forschungsprojekten oder die Abschottung von Märkten. Die bestehenden Leitlinien griffen diese Aspekte bislang nur begrenzt auf, eine Aktualisierung erscheint dem Amt sinnvoll, sie müsse aber klaren wettbewerblichen Maßstäben folgen.
Im Bereich Effizienzen sieht das Bundeskartellamt keinen grundsätzlichen Änderungsbedarf. Zwar seien Effizienzgewinne anerkannt, doch ihre Berücksichtigung sei an strenge Voraussetzungen gebunden. Die Kommission habe bislang keinen Fall allein wegen Effizienzgewinnen freigegeben. Das Papier plädiert für eine Klarstellung, warum Effizienzen bisher nur selten anerkannt wurden.